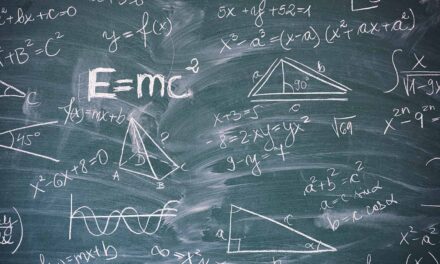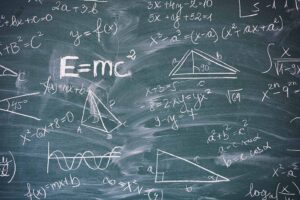Ein Wetterumschwung steht bevor – und du hast Kopfschmerzen, fühlst dich müde oder gereizt? Du bist nicht allein. Viele Menschen berichten, dass sich ihr Wohlbefinden verändert, sobald das Wetter kippt – noch bevor sich der erste Regentropfen zeigt oder der Wind auffrischt.
Doch was steckt wirklich hinter dem Phänomen der Wetterfühligkeit? Ist es ein real messbares Zusammenspiel von Körper und Atmosphäre – oder nur Einbildung? Und warum betrifft es manche Menschen mehr als andere?
In diesem Artikel gehen wir dem Phänomen auf den Grund: Was ist Wetterfühligkeit? Welche Symptome treten auf? Was sagt die Forschung dazu? Und wie kannst du dich schützen?
1. Was ist Wetterfühligkeit überhaupt?
Der Begriff Wetterfühligkeit beschreibt eine körperliche oder psychische Reaktion auf Veränderungen des Wetters – oft, noch bevor sich diese äußerlich bemerkbar machen. Betroffene klagen über Beschwerden wie Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Schlafprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten.
Wichtig: Wetterfühligkeit ist keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern ein subjektives Empfinden. Es handelt sich dabei nicht um eine medizinisch anerkannte Diagnose – doch die Beschwerden sind für viele Menschen sehr real.
Unterschied Wetterfühligkeit vs. Wetterempfindlichkeit
- Wetterfühligkeit: Der Körper reagiert auf Wetterwechsel – z. B. durch Kreislaufprobleme oder Unwohlsein.
- Wetterempfindlichkeit: Bestehende Erkrankungen (z. B. Rheuma, Asthma, Migräne) verschlechtern sich bei bestimmten Wetterlagen.
Wetterfühligkeit betrifft grundsätzlich gesunde Menschen – Wetterempfindlichkeit hingegen bezieht sich auf wetterbedingte Verschlechterungen bereits bestehender Krankheiten.
Statistisch betrachtet gibt es Hinweise, dass bis zu 50 % der Bevölkerung zumindest gelegentlich wetterfühlig reagieren – Frauen häufiger als Männer, ältere Menschen stärker als jüngere.

2. Symptome und typische Reaktionen auf Wetterumschwünge
Wetterfühligkeit äußert sich auf ganz unterschiedliche Weise – je nach Person, Wetterlage und Tagesform. Manche spüren nur eine leichte Müdigkeit, andere kämpfen regelrecht mit ihrem Kreislauf. Die häufigsten Beschwerden treten vor, während oder nach einem Wetterwechsel auf – insbesondere bei starkem Luftdruckabfall oder Temperatursturz.
Typische Symptome von Wetterfühligkeit:
- 🌧️ Kopfschmerzen oder Migräne
- 🌬️ Kreislaufprobleme (z. B. Schwindel, Schwächegefühl)
- 🌡️ Gelenk- oder Gliederschmerzen
- 😴 Schlafstörungen oder Tagesmüdigkeit
- 💢 Reizbarkeit, Nervosität oder depressive Verstimmung
- ❤️ Herzrhythmusstörungen oder Unruhegefühle (seltener)
Besonders intensiv reagieren viele Menschen auf:
- starken Luftdruckabfall vor Gewittern oder Tiefdruckgebieten
- Föhnwetterlagen mit trockener, warmer Luft und Wind
- plötzliche Temperaturwechsel (z. B. Wettersturz im Frühling oder Herbst)
Laut einer Umfrage der DAK fühlen sich rund 64 % der Deutschen wetterfühlig. Besonders betroffen sind Menschen mit niedrigem Blutdruck, sensibler Psyche oder chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder Migräne.
Wichtig ist: Die Symptome sind zwar unangenehm, aber in der Regel nicht gefährlich. Dennoch können sie die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen – vor allem, wenn sie regelmäßig auftreten.

3. Was sagt die Wissenschaft zur Wetterfühligkeit?
Wetterfühligkeit ist ein Phänomen, das zwar von vielen Menschen erlebt wird – aber in der Wissenschaft lange Zeit umstritten war. Gibt es wirklich einen messbaren Zusammenhang zwischen Wetter und körperlichem Befinden? Oder handelt es sich vor allem um subjektive Wahrnehmung?
Inzwischen gibt es zahlreiche medizinische und meteorologische Studien, die bestimmte Wetterlagen mit gesundheitlichen Reaktionen in Verbindung bringen – etwa bei Migräne, Rheuma oder Stimmungsschwankungen.
Mögliche biologische Ursachen:
- Luftdruckschwankungen: können den Gleichgewichtssinn und das vegetative Nervensystem reizen
- Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel: beeinflussen den Kreislauf, die Gefäße und den Blutdruck
- Wind & Ionisation: Föhnwinde wie in den Alpen beeinflussen das Wohlbefinden über positiv geladene Ionen
- Hormonelle Reaktionen: u. a. veränderter Serotonin- oder Histaminspiegel bei Wetterwechsel
Eine Meta-Analyse der Universität Augsburg (2021) fand Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Wetterwechseln und Kopfschmerzen bei wetterfühligen Personen. Allerdings sind die Effekte individuell sehr unterschiedlich – und nicht immer messbar.
Besonders häufig untersucht wurden:
- 🔬 Migräne: viele Betroffene reagieren auf Föhn, Temperaturanstiege oder Luftdruckabfall
- 🦴 Rheuma & Arthrose: Gelenkschmerzen nehmen oft bei Kälte und Nässe zu
- 🧠 Psychische Verstimmungen: saisonale Schwankungen (z. B. Frühjahrsmüdigkeit oder Winterblues)
Die Forschung geht davon aus, dass es sich um ein multifaktorielles Zusammenspiel handelt: Wetterreize, genetische Veranlagung, hormonelle Schwankungen und psychische Faktoren wirken gemeinsam.
4. Wetterfühligkeit & Placebo-Effekt: Macht der Kopf das Wetter schlimmer?
Ein oft übersehener Aspekt bei Wetterfühligkeit ist die Rolle der Erwartungshaltung. Wenn du davon ausgehst, dass du bei Regen Kopfschmerzen bekommst – ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du sie auch bekommst. Dieser Effekt ist in der Psychologie als Nocebo-Effekt bekannt: Negative Erwartungen können körperliche Reaktionen hervorrufen oder verstärken.
Das bedeutet nicht, dass sich Betroffene ihre Beschwerden nur einbilden. Vielmehr zeigt sich, wie stark psychologische Prozesse körperliche Empfindungen beeinflussen können.
Wenn du schon Tage zuvor im Wetterbericht hörst, dass ein Tiefdruckgebiet im Anmarsch ist, beginnst du dich darauf einzustellen – oft unbewusst. Die Folge: Dein Körper „erwartet“ die Reaktion und sendet entsprechende Signale.
Was Studien zeigen:
- Personen, die glauben, wetterfühlig zu sein, berichten deutlich häufiger über Symptome – auch wenn objektiv kein Wetterwechsel stattfand.
- Umgekehrt zeigen manche Menschen klare körperliche Reaktionen auf Wetterveränderungen, obwohl sie sich selbst nicht als wetterfühlig einstufen.
Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es keine einfache Schwarz-Weiß-Erklärung gibt. Vielmehr entsteht Wetterfühligkeit aus einem Zusammenspiel biologischer Reize, individueller Empfänglichkeit und psychologischer Erwartungen.
Der Körper reagiert – aber der Kopf spielt dabei oft eine größere Rolle, als wir denken.
5. Was hilft gegen Wetterfühligkeit?
Wetterfühligkeit lässt sich nicht „wegtherapieren“ – aber du kannst viel tun, um die Beschwerden zu lindern oder ihnen vorzubeugen. Besonders wichtig: regelmäßige Routinen, körperliche Ausgeglichenheit und ein bewusster Umgang mit deinem eigenen Körpergefühl.
Tipps für den Alltag:
- 🚶♀️ Bewegung an der frischen Luft: Spaziergänge – auch bei schlechtem Wetter – stärken Kreislauf, Nerven und Immunsystem.
- 💧 Ausreichend trinken: Dehydration verschlimmert viele typische Symptome wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit.
- 🧘 Entspannungstechniken: Yoga, Meditation oder Atemübungen helfen, das vegetative Nervensystem zu regulieren.
- 🌿 Ernährung: Magnesiumreiche Kost (z. B. Haferflocken, Nüsse, Spinat) unterstützt die Nervenfunktion und wirkt krampflösend.
- 🛏️ Schlafrhythmus stabilisieren: Wetterwechsel können den Schlaf stören – feste Schlafzeiten wirken dagegen.
Wetterfühligkeit tritt oft dann besonders stark auf, wenn Körper und Psyche ohnehin „aus dem Takt“ sind. Je stabiler deine Routinen – desto geringer die Reaktion auf äußere Reize.
Wann sollte man ärztlichen Rat einholen?
Wenn deine Beschwerden regelmäßig sehr stark ausfallen oder deine Lebensqualität deutlich einschränken, solltest du medizinischen Rat suchen – vor allem bei:
- anhaltenden Kopfschmerzen oder Migräne
- Herz-Kreislauf-Beschwerden
- depressiven Verstimmungen
Wichtig: Wetterfühligkeit kann echte Krankheiten überdecken oder verstärken – deshalb lohnt sich eine fundierte Abklärung, wenn du unsicher bist.
Weiterführende Links & Ressourcen zu Wetterfühligkeit
Artikel auf Neptun.one
Externe, aktuelle Quellen zur Wetterfühligkeit
❓ Häufige Fragen zur Wetterfühligkeit
Was genau ist Wetterfühligkeit?
Wetterfühligkeit beschreibt körperliche oder psychische Beschwerden, die durch Wetterveränderungen ausgelöst oder verstärkt werden – wie Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme oder Stimmungsschwankungen.
Welche Symptome sind typisch?
Häufige Beschwerden sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen oder Reizbarkeit – meist bei Luftdruckabfall oder Wetterumschwüngen.
Wie unterscheidet sich Wetterfühligkeit von Wetterempfindlichkeit?
Wetterfühligkeit betrifft gesunde Menschen mit temporären Beschwerden. Wetterempfindlichkeit bezieht sich auf das Verschlechtern bestehender Krankheiten wie Rheuma, Migräne oder Asthma durch das Wetter.
Was sagt die Wissenschaft dazu?
Es gibt Hinweise auf biologische Reaktionen bei Luftdruck- oder Temperaturveränderungen. Die Effekte sind individuell sehr unterschiedlich und teilweise schwer messbar – psychologische Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle.
Kann man etwas dagegen tun?
Ja. Bewegung an der frischen Luft, viel trinken, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und Entspannungstechniken helfen vielen Betroffenen. Bei starken Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
Ist Wetterfühligkeit Einbildung?
Nein. Auch wenn psychologische Faktoren wie Erwartung und Wahrnehmung eine Rolle spielen, berichten viele Menschen nachvollziehbar und wiederholt von realen Beschwerden. Wetterfühligkeit ist ein ernstzunehmendes Phänomen.